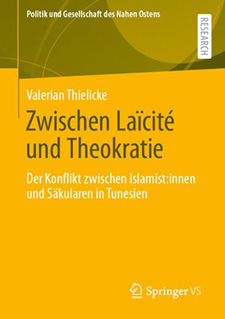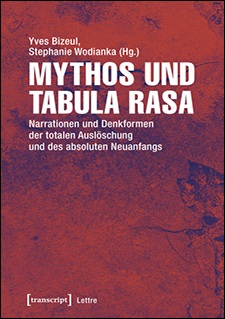Publikationen des Lehrstuhls für Politische Theorie und Ideengeschichte
Im Folgenden sind die Publikationen des Lehrstuhls aufgelistet. Weitere Publikationen finden Sie bei den jeweiligen Profilen der MitarbeiterInnen.
Bücher (Monographien und Sammelbände)
Zwischen Laïcité und Theokratie - Der Konflikt zwischen Islamist:innen und Säkularen in Tunesien
Valerian Thielicke, Wiesbaden: Springer VS, 2021, 268 S.
Seit dem Übergang zur Demokratie in Tunesien scheint der Konflikt zwischen der islamistischen Ennahda und den nichtislamistischen Parteien das Parteiensystem zu strukturieren, dennoch besteht Uneinigkeit über den Konfliktgegenstand. Durch eine vertiefte Analyse der vorfindbaren kollektiven belief systems, konnte der Band den Unterschied in den Wertevorstellungen und Ansichten der Islamist:innen und Nichtislamist:innen herausarbeiten und zeigen, dass sie sich tatsächlich unterscheiden. Dabei steht nicht die Ordnung des religiösen Feldes bzw. das Verhältnis der Religion im Staat im Zentrum, sondern ihre Vorstellungen von der nationalen identität und der idealen Einrichtung der Demokratie.
"Mythos und Tabula Rasa. Narrationen und Denkformen der totalen Auslöschung und des absoluten Neuanfangs"
Yves Bizeul und Stephanie Wodianka (Hrsg.), Bielefeld: Transcript, 2018, 178 S.
Anders als die bisherige Forschung, die stets die konstruktiven Aspekte von Gründungsmythen profilierte, zeigt der Band die destruktive, Auslöschung voraussetzende oder anstrebende Dimension des Mythos auf. Dabei soll vor allem die Frage beantwortet werden, ob es eine Seite mythischer (Gründungs-)Narrative gibt, die Konstruktionen des Nullpunkts – insbesondere in Deutungskonflikten – erfordern oder begünstigen. Die Beiträge stellen aus interdisziplinärer Perspektive historische und politische Umbruchsituationen sowie narrative Strategien in den Fokus, welche Denkformen des Kahlschlags repräsentieren und deren Relation zu mythischen Gründungerzählungen illustrieren.
"Glaube und Politik"
Yves Bizeul, Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, 315 S.
Selten besteht Politik aus rein zweckrationalem Handeln. Politische Überzeugungen entstehen nur begrenzt aus der Kraft der besseren Argumente im politischen Diskurs oder aus der Fähigkeit, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Neben der Legitimation durch Diskurs- und Zweckrationalität spielen vor allem auch nicht reflektierte vorpolitische Auffassungen eine bedeutende Rolle sowohl bei der Stabilisierung eines politischen Systems als auch bei der politischen Mobilisierung. Dieses Buch untersucht die Relevanz des religiösen wie auch des politischen Glaubens für die Politik.